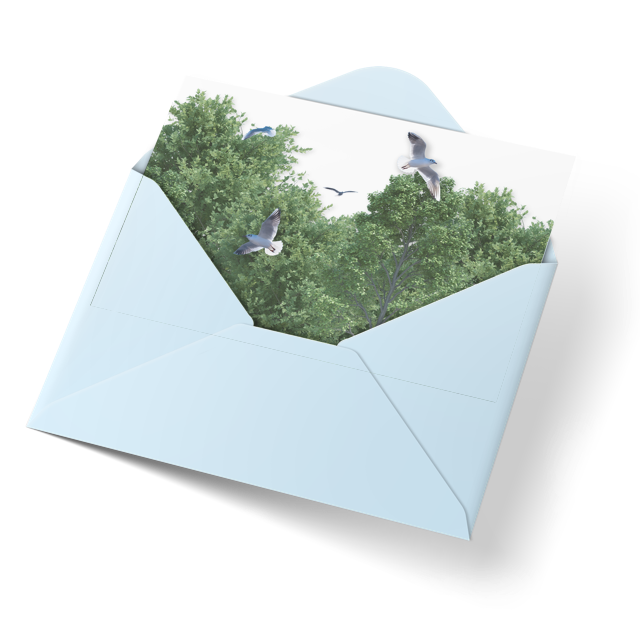Stimmungsmacher der Natur
Pfeifen, zwitschern, musizieren... Besonders in den Frühlingsmonaten entzücken uns Singvögel als Vorboten einer helleren, wärmeren Jahreszeit mit ihrem ausdauernden Symphoniekonzert. Singvogelarten wie die Blaumeise (Cyanistes caeruleus), die Nachtigall (Luscinia megarhynchos) oder das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) haben sich mit den vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaften arrangiert. Fast jeder kennt sie. Unbekanntere Arten wie Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) und Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) leben eher abseits menschlicher Gefilde. Doch die Melodien einiger Singvogelarten ertönen immer seltener. Der Bestand des Baumpiepers (Anthus trivialis) beispielsweise sank in den vergangenen Jahren in einigen Gebieten um bis zu 80 Prozent.